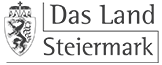Baby Blue Eyes ... und noch einiges mehr als das. Über Texte von Sophie Reyer.
Also mal sehen ... Sophie Reyer. Von „Sprödigkeit" und „Körperprosa" ist da gern mal die Rede, wenn RezensentInnen darangehen, sich mit ihren Hervorbringungen zu beschäftigen. Von jenem Grenzbereich zwischen literarischen und musikalischen Denk- und Verfahrensweisen, in dem die Grazer Autorin und Kompositionsstudentin unterwegs ist, sowohl, was ihr Schreiben, als auch, was ihr Reden-übers-Schreiben betrifft. Schließlich von ihrer „Jugend", als wäre die irgendwie literarisch relevant, und nicht bloß, was leider zutrifft, marketingtechnisch. Wobei aber die Zusammenschau dieser ihrer „Jugend" und der schieren Fülle an literarischen Projekten, mit denen sie derzeit befasst ist, durchaus beeindruckt.
Da wären zunächst, auch als Lieblingsanlass der o.g. Rezensionen, die zwei Bücher, die 2008 von ihr erschienen sind: „Baby Blue Eyes" (Ritter) und „Vertrocknete Vögel" (Leykam). Beide umkreisen, mit unterschiedlichen Versuchsbedingungen, einen Zustand, den ich die Unbehaustheit im eigenen Körper nennen würde. Beide Bücher legen uns implizit nahe, dass aus solcher Unbehaustheit auch die in den sozialen Netzen folgt, in Konstrukten wie „Familie" und „Freundeskreis". Die Grenzen zwischen vermeintlich sicheren Identitäten verschwimmen in diesen Prosen mit dem Wechsel zwischen körperlichen Zuständen und Befindlichkeiten - Ego und Sprache erscheinen hier gleichermaßen (jetzt mal überzeichnet ausgedrückt) als Funktionen der Verdauungs- und Fortpflanzungsapparate der Körper. Die mit solcher Wahrnehmung einhergehende Verunsicherung (der sich das Adjektiv „spröde" in den Rezensionen zu verdanken scheint) wird auf sprachlicher Ebene greifbarer in „Baby Blue Eyes", während „Vertrocknete Vögel", der nach Auskunft Reyers ältere Text, näher an einem Storytelling im klassischen Sinne ist („näher" ist hier relativ zu lesen, in demselben Sinne, wie die Venus der Sonne näher ist als die Erde ...).
Nun hat Reyer, wie aufmerksame BeobachterInnen der Literaturlandschaft wissen, auf das eben umrissene Repertoire kein Monopol. Ein Textkosmos, der ihrem zwar, genauer betrachtet, nicht besonders ähnlich sieht, aber in ähnlicher Weise („spröde", „(Frauen-)Körper", „musikalisch") rezipiert wird, wurde ja vor gar nicht langer Zeit sogar für nobelpreiswürdig befunden. Das soll nicht bedeuten, ihre Arbeit wäre in irgendeiner Weise epigonal - bloß, dass es sich bei ihr nicht um das „Fräuleinwunder" handelt, das gleichsam im luftleeren Raum ihre genuinen Lebensäußerungen absondert, die dann mit nichts als mit dem Autorinnenkörper zu tun hätten. Nein: Reyer operiert mit Kenntnis von und in Anschluss an die relevanten Diskurse, die aktuell um die Möglichkeiten von Text kreisen. Sie operiert, mit anderen Worten, souverän.
Die ebenso grundfalsche wie (gerade von professionellen LiteraturvermittlerInnen, und nicht nur im Fall Reyer) gerne praktizierte Leseweise, die zunächst nach „Biografie" fragt, will letztlich (und durchaus nicht notwendigerweise bewusst) auf eine kathartische Leseerfahrung hinaus, die dem Sozialvoyeurismus gleicht, wie er bestimmte Fernsehprogramme funktionieren lässt: Auf die verschmitzt-lüsterne Beobachtung anscheinender Lebensuntüchtigkeiten, Schwächen, Hinfälligkeiten, wie sie sich in vermeintlich „authentischen" Sprachen und Sprachdeformationen offenbaren, und von denen dann das LeserInnen-Subjekt dankenswerterweise frei zu sein sich in solcher Beobachtung versichern kann. Es ist das Verdienst der Charlotte Roches dieser Welt um den Literaturbetrieb, dass er nicht mehr gefeit ist davor, für ein Schaufenster abstruser Persönlichkeitsentwicklungen gehalten zu werden. Nicht mehr ist das Vorverständnis vorauszusetzen, dass artifizielle Sprache etwas anderes wollen kann, als Nabelschau zu treiben und dafür Alimentierung einzufordern. Die Autorin selbst meint dazu lapidar: „Um Autobiografie geht es tatsächlich nicht." Die Frage nach ihr führe ins Leere, und das Wissen um biografische Daten trage nichts zum Verständnis ihrer Texte bei.
Texte wie die von Sophie Reyer fallen dieser Entwicklung meiner Meinung nach auch deswegen häufig zum Opfer, weil die voyeuristische Perspektive einen nicht zu unterschätzenden Schutz des LeserInnen-Subjekts vor der ungeheuerlichen Schmerzhaftigkeit der Spracherfahrungen darstellt, zu denen Reyer uns hinführt: Die Tragweite der Erkenntnis, dass mit dem Ich auch das Soziale in die Körper eingeschrieben sei und darüber sich reproduziere - als warmes Nest ebenso wie als unentrinnbarer Zwangszusammenhang -, offenbart sich in Reyers Prosa, und es handelt sich bei den Schocks, die sie in diesem Sinn an einigen Stellen auslöst, durchaus nicht um „Effekte" (nach Richard Wagners Definition „Wirkung ohne Ursache").
Aber halt: Eingangs war die Rede von einer „schieren Fülle an literarischen Projekten", und bisher war nur die Rede von zwei Büchern und ihrer Rezeption. So nötig es war, da einiges richtigzustellen, so sehr sind diese 2008 erschienenen Prosaarbeiten mitsamt ihren Implikationen und den Projektionsflächen, die sie eröffnen, nur ein Teil des aktuellen Schaffens von Sophie Reyer. Über die „reine" Prosa hinaus ist die Autorin nämlich gerade dabei, „Dependencen" in Rezeptionsräumen zu eröffnen, die für die angedeuteten Missverständnisse vermutlich weniger Platz lassen werden: Im Bereich der Dramatik und im Grenzbereich zwischen Belletristik und Diskurs.
Zuerst zum Drama: Am 4. Mai 2009 wird im Theater in der Drachengasse in Wien das Stück „Schneewittchenpsychose" uraufgeführt, das Reyer gemeinsam mit der Performancegruppe „faimme" erarbeitet hat (deren Name sich aus einer Zusammenziehung der französischen Worte für „Hunger" und „Frau" ergibt). Wie schon der Titel erahnen lässt, bleibt sie in dieser Arbeit zumindest thematisch der Stoßrichtung ihrer Prosa treu, wobei aber die Feststellung nicht genug betont werden kann, dass es sich bei „faimme" nicht um ein klassisches Theaterensemble handelt: Zu erwarten hat das interessierte Publikum nicht hauptsächlich ausgebreitete Figurenrede, sondern eine Performance, bei der das Verschwimmen bzw. der Verlust der Ich- und Sprach-Grenzen, wie wir ihn aus ihren Büchern kennen, auf die Ebene der Medien und ihrer Möglichkeiten gehoben zu werden verspricht.
Was nun den Grenzbereich zum Diskurs betrifft: Sophie Reyer ist neben anderem eine regelmäßige Beiträgerin der Literaturzeitschrift „perspektive", in der die Intertextualität und „Meta-Literatur" eine gewisse Tradition hat. Ein Teil der Beiträge jeder Nummer sind Texte, die im Teamwork von mehreren Autoren verfasst werden, sei es in Form von Diskussionsartikeln, sei es in Form dialogischer Texte, sei es in Form von Texten, denen mensch nicht mehr so ohne weiteres ansieht, wer was geschrieben hat. In diesem Kontext entstand die Idee zu „Banana Boat (Drift Text)", an dem Reyer gemeinsam mit dem Berliner Autor Ralf B. Korte arbeitet und der sie laut Eigenauskunft „sicher einige Jahre beschäftigen" wird. Aktuelle Auszüge dieser Arbeit sind in Heft 59/60 der „perspektive" nachzulesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden VerfasserInnen „auch mal was Längeres publizieren" (dass Reyer da nicht vom ganzen Text redet, sondern von „was Längere{m}", erklärt, wie umfangreich sie die Arbeit angelegt sieht).
„Banana Boat (Drift Text)" handelt „im Prinzip von sprachlicher Interaktion. Es geht um Reaktionen und Re-Reaktionen innerhalb eines Textes." Man verwende auch, so Reyer, „Feldmaterial", etwa Liedtexte und Schlagzeilen. „Es geht darum, wie sich Material im Dialog verwandelt und durch unterschiedliche Filter läuft." In einem das Projekt beschreibenden Text der AutorInnen heißt es erklärend: „Das Prosaprojekt versucht, ausgehend vom Körper und den in ihm gespeicherten Daten, über Generations- und Geschlechtsdifferenzen der beiden Proponenten hinweg an dieses ‚utopische ZWISCHEN' zu kommen und dort eine mögliche neue Form von Sprache zu finden." Ob das Team diesem Anspruch genüge tut, wird nachzulesen bleiben müssen. Gegen kritikseitigen Fehlleistungen wie den oben dargelegten (oder vielleicht selbst den in vorliegendem Text enthaltenen) gibt es für LeserInnen nur einen einzigen zuverlässigen Schutz gibt: Selber lesen!
Stefan Schmitzer, Jänner 2009