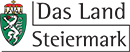Das Gute an Gedichten
Christian Teissl lebt in Archiven, pflegt und publiziert Historisches, dokumentiert als Spracharchäologe, veröffentlichte mehrere Gedichtbände und erhielt dafür Lyrik-Preise. Derzeit schreibt er an einem Band imaginärer Porträts.
Sahra Foetschl: Du bist als Herausgeber aktiv, schreibst Feuilleton und Glossen für verschiedene Zeitungen, bist im Literaturbetrieb aber vor allem als Lyrikschreiber bekannt ...
Christian Teissl: Lass ich mich auf ein Wort ein, so lande ich viel eher beim Vers als bei der Prosa - wobei die Grenzen durchaus fließend sind. Auch jeden Prosasatz, den ich schreibe, kann ich erst dann stehen lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass sein Sound, sein Rhythmus stimmen, dass er nicht nur lesbar, sondern auch sagbar ist.
Bevor mein erster Gedichtband erschienen ist, habe ich auch mehrere Hörspiele verfasst - sehr abstrakte Dinge.
Welches Hörspiel hast du hundertmal gehört?
Eine Hörspielfassung des deutschen Pinocchio, den der Münchner Dichter Otto Julius Bierbaum um 1900 unter dem Titel "Zäpfel Kerns Abenteuer" herausgebracht hat. Darin kommen immerhin so denkwürdige Sätze vor wie dieser: "Bei uns in Deutschland gibt's keine Räuber, nur Polizisten!" - Das Band mit diesem Hörspiel habe ich mir als Kind sicher hundertmal angehört, und ich besitze es heute noch.
Wo schreibst du Lyrik: unterwegs im Zug oder zuhause in Ruhe, kathartisch, zur Regeneration?
Das Gute an Gedichten ist, dass sie immer und überall entstehen und auch zwischen Tür und Angel gelesen werden können. Sie sind eine leichte Fracht - was nicht heißt, dass sie leichte Geburten sind. Bei mir jedenfalls sind sie das mit den Jahren immer seltener: Von der Erstniederschrift eines Gedichts im Notizbuch oder auf Schmierzetteln bleibt am Ende, am Bildschirm, in der Datei, nicht viel mehr übrig als bestenfalls ein, zwei Verse oder ein einzelnes Bild.
Universität Graz! Emotional schon sehr weit weg?
Meine Diplomarbeit, die später auch als Buch erschienen ist, habe ich über den Kärntner Dichter Michael Guttenbrunner (1919-2004) geschrieben, den ich, als die Arbeit fertig war, auch persönlich kennenlernen durfte. Wir haben in seinen letzten anderthalb Lebensjahren an die 40 Briefe gewechselt, und ich habe ihn dreimal in Wien besucht. Bis in den Satzbau hinein hat er mich damals beeinflusst, und als er gestorben war, habe ich versucht, seine Art der eingreifenden, polemischen Kurzprosa zu imitieren - Versuche für die Schublade, die ich Gott sei Dank niemandem zur Veröffentlichung angeboten habe. Von dieser Überfigur musste ich mich in der Zwischenzeit emanzipieren, und doch bleibt Guttenbrunner, auch als Lyriker, ein wichtiger Autor für mich.
Arbeitest du noch mit der Grazer Uni zusammen?
Ein erstes Dissertationsprojekt habe ich sanft dahinsterben lassen, dann am Projekt "Steirische Literaturpfade des Mittelalters" mitgearbeitet, daraus hat sich für mich ein neues Dissertationsthema ergeben: über Herrand von Wildon, einem Novellisten und Minnesänger aus dem 13. Jahrhundert.
Beweisführungen einer Daseinsberechtigung als Literat gegenüber den Eltern?
Mein Bruder und ich sind die ersten in unserer Familie, die Matura gemacht haben. Unser Weg, unser Werdegang hat innerhalb unserer Familie keine Tradition. Ohne elterlichen Bücherschrank aufgewachsen zu sein, habe ich aber nie als Unglück betrachtet, doch bemerke ich an mir eine ewige Unsicherheit im Sprechen, ein ständiges Schwanken zwischen der Sprache von Daheim, die stark vom Dialekt gefärbt ist, und der Sprache, in der ich mich beruflich bewege. Durch meine Sprachmaske geht ein Riss, unüberhörbar.
Mit meinem seltsamen Beruf haben sich meine Eltern schließlich abgefunden, als sie bemerkt haben, dass damit immerhin so etwas wie öffentliche Präsenz, öffentliche Resonanz verbunden ist. Den Beweis meiner Daseinsberechtigung als Literat habe ich meinen Eltern gegenüber also vor allem durch meine Zeitungsarbeiten geführt, aber auch durch ein Buch wie "Wir vom Jahrgang 1979" - eine enorm wichtige Erfahrung, nicht bloß ein Fall von literarischem Söldnertum.
Hat dich die "Finanzkrise" in den letzten Jahren gestreift?
Die Honorare sind im Allgemeinen kärglicher geworden, keine Frage, und ich habe den Eindruck, dass das Geld heute viel schneller dahinschmilzt als noch vor zehn Jahren. Auf einen fetten Monat folgen zwei magere ... Aber man lebt.
Wie arrangiert man sich als akademischer Wissensarbeiter und Autor mit dem journalistischen Bereich, der gerade stark von den zahlreichen Fachhochschul-Absolventen geprägt wird?
In der journalistischen Zunft bin und bleibe ich ein blinder Passagier, allerdings einer, von dem man Maßarbeit bekommt, so gut wie satzreife Beiträge. Das wissen, zum Glück, immerhin einige wenige Redakteurinnen und Redakteure.
Ich habe nicht einen Tag in der Redaktion einer Zeitung gearbeitet, sondern immer nur als literarischer Hausierer dort angeklopft, mit einem Bauchladen voller Ideen: "Wären Sie an diesem oder jenem Thema interessiert? Können Sie das und das gebrauchen?" - manchmal mit Erfolg, manchmal vergeblich.
Wie lebt es sich als Herausgeber mit dem Material anderer, zwischen Archiven und Rezensionen?
Sich derart viel in fremden Werken aufzuhalten ist eine zweischneidige Angelegenheit: Auf der einen Seite schafft man sich dadurch ein Rückzugsgebiet, ein literarisches Hinterland, auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass man sich von einem kreativen in einen mehr und mehr rezeptiven Menschen verwandelt, von einem, der auszog, Literatur zu machen, zu einem, der nur noch als Literaturforscher gilt und als "Kenner" geschätzt wird.
Du hast auch historisch-dokumentarische Arbeiten gemacht, etwa zum Grazer Dichter Ernst Goll (1887-1912) sowie eine Dokumentation über Literatur zur Eisenstraße (1938-1945). Untertitel: NS-Terror - Widerstand - Neues Erinnern.
Mein Zeichenlehrer in Leibnitz gab mir Gedichte von Ernst Goll, da war ich 17 Jahre alt. Von da an haben sie mich begleitet, und als der 100. Todestag in Sicht kam, sagte ich mir, ich muss etwas unternehmen. Daraus ist dann eine Obsession geworden ...
Wissen wir mittlerweile genug über die NS-Zeit oder haben wir noch immer nicht genug begriffen?
Ich denke, dass bestimmte Verhaltens- und Umgangsformen in der österreichischen Gesellschaft, die bis heute durch Erziehung weitergegeben werden, zwar nicht unbedingt ihren Ursprung in der NS-Zeit haben, wohl aber von dieser Zeit entscheidend befördert wurden und dementsprechend von ihr getränkt, imprägniert sind. In Haltungen wie "Nur nicht auffallen!" oder "Ein Mann darf keine Tränen zeigen!" oder "Nur die Harten kommen durch!" oder "Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter!" wirkt der Faschismus hier und heute unterschwellig weiter. Die viel zitierte "Vergangenheitsbewältigung" ist also nicht nur historische Aufarbeitung, sondern eine Gegenwartskunde, eine Archäologie der eigenen Gegenwart.
Bleibt noch Zeit für eigene kreative Werksentwürfe?
Seit zwei Jahren laboriere ich an einem Band mit Geschichten in der Form imaginärer Portraits. Das Ganze soll "Die nähere Umgebung" heißen, und ich hoffe, es nun endlich bald fertig zu haben. Es soll eine Galerie werden, in der sowohl Land- als auch Stadtbewohner vorkommen, vor allem aber Figuren, die meine Kindheit bevölkert haben und die durch meine Erinnerung geistern - teils schon ziemlich gesichtslos, teils mit verschiedenen Gesichtern. Keine Lebensgeschichten will ich hier erzählen, sondern Momentaufnahmen geben, aus verschiedenen Perspektiven, Personenbeschreibungen, die im Handumdrehen zu kleinen Geschichten geraten.
Was fehlt, um sich langfristig aus der Stadt raus in einem Landhaus in der Südsteiermark mit vielen Büchern und gutem Essen niederzulassen, sich der Botanik zu widmen?
Es fehlt viel, wobei ich gar nicht weiß, ob ich wirklich die Stadt wieder verlassen will ...
Jüngste Veröffentlichungen und Beiträge von Christian Teissl:
Gespräch über Bäume. Moderne deutsche Naturlyrik
Hrsg. von Hiltrud Gnüg
Reclam 2013
Christian Teissl: Wir vom Jahrgang 1979.
Kindheit und Jugend in Österreich
Wartberg-Verlag 2013
Die Eisenstraße 1938-1945: NS-Terror - Widerstand - Neues Erinnern.
CLIO: Graz 2013
Otto Laaber: Ausgewählte Gedichte 1952-1973
Hrsg. und mit einer Einleitung von Christian Teissl.
Podium: Wien 2013
Ernst Goll: Im bitteren Menschenland
Das gesammelte Werk. Hrsg. und kommentiert von Christian Teissl.
Igel-Verlag, Hamburg 2012
Sahra G. Foetschl
Stand: April 2014