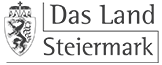Ein „Babylonischer Contemporary Avantgardist“
Der steirische Medienkunstpionier Heribert Hirschmann (1955 - 2016) übersetzte Information in Kunst.
„Ich bin ein Gastarbeiterkind", sagt Heribert Hirschmann, „geboren 1955 in der Schweiz." Als er neun Jahre alt ist, kehren seine Eltern in die Steiermark zurück und Heribert landet als Alien mit schwyzerdütschem Dialekt in der Volksschule. Sein bester Freund damals leidet an Muskelschwund und sitzt im Rollstuhl. Der Freund weiß auch, dass man mit dieser Krankheit kaum älter wird als 24. Das Verschwinden von Menschen wird so eine der wichtigen Fragen in Heribert Hirschmanns künstlerischer Arbeit werden, ebenso wie das parallele Universum, das nur aus Information bestehet, das er in unser euklidisches System übertragen möchte. „Kunst hat ja immer etwas mit Sichtbarmachen zu tun ..."
Aber noch ist es nicht so weit. Heribert Hirschmann beginnt eine Lehre als Radio- und Fernsehmechaniker und hat einen Unfall mit dem Fahrrad. Dabei stellt man fest, dass er noch schulpflichtig ist und so kommt er ins Polytechnikum Unterpremstätten. „Völlig verrückt, der Werkraum war auf der Bühne vom Kultursaal".
Danach besucht er das MUPÄD in Graz und macht die Matura. Er besitzt noch Tonarbeiten aus seiner Schulzeit, und daran erkennt man bereits eine außerordentliche gestalterische Begabung. Nicht nur sind die Figuren sorgfältig durchgearbeitet, sondern er scheut sich auch nicht, die Formen bis an ihr filigranes Ende durchzuhalten. Nach der Matura studiert Heribert Hirschmann Kunstpädagogik in Linz. „Die Kunstpädagogik war die beste Möglichkeit, alle Kunstsparten kennenzulernen. Film, Fotografie, Malerei, Bildhauerei ..." Unser Gespräch verirrt sich in die Fachdidaktik: „Hiebkritzeln, Urknäuel ..."
„Du bist also Magister?"
„Vergiss das ganz schnell wieder!"
Heribert Hirschmann unterrichtet dann auch einige Jahre. Mitte der 1980er-Jahre könnte er mit seiner Malerei auch „neuer Wilder" werden, aber das will er dann doch nicht. „Ich mag auch nicht die heutige DJ-Culture, wo sich jeder, der Platten auflegt, für einen Künstler hält."
Man merkt seinen frühen Bildern auch an, dass Heribert Hirschmann weniger ein Maler sein wollte, sondern ihn mehr das thematische Feld selbst interessiert, deshalb erweiterte er, wo es ihm notwendig erschien, die Bildfläche mit Pappmaché in den Raum hinein.
„Mein letztes Tafelbild habe ich Ende der 80er-Jahre gemalt, weil sie mir schon in der Schule sagten, wenn ich ein Bild gemalt habe: ‚Schau dir den und den Maler an!‘ Ich wollte mir aber den und den nicht anschauen." So merkt man bereits in Hirschmanns frühen Arbeiten, dass hier jemand seine eigene Weltsicht ganz originär sortieren möchte. Daher der Wunsch und die konkreten Anstalten, bewusst träumen zu können - auch ein Wunsch, dem Unwillkürlichen bewusst Bilder abzufordern, der später wesentliche Grundlage für seine künstlerische Arbeit wird, um den Grenzbereichen zur Digitalwelt Bildbrücken abzuringen. So nahm er schon 1978 auf der Kunsthochschule am Wettbewerb „Das neue Porträt" teil. Dabei beklebte er die Bildfläche mit Tonbandstreifen und montierte einen Tonabnehmer auf einen Zeigestab, wodurch man mittels Bewegung des Stabes über die Bildfläche aus Bewegung und Ton Bilder suggerieren konnte.
„Eigentlich komme ich ja vom Schreiben", sagt Heribert Hirschmann, und holt einen vergilbten Ordner, in dem sich unterschiedlichste Texte und Fragmente befinden. Einer der Texte, der sich auf Selbsterlebtes gründet: Ein junger Mann wird ins Krankenhaus eingeliefert und erlebt sich immer wiederholende Szenen, die sich ihm als unterschiedliche Wirklichkeitszugänge anbieten, worauf er die Krankenschwester bittet, draußen nachzusehen, ob die Frau noch da ist, die ihn hierher begleitet hat: Für die Wirklichkeit, in der es diese Frau gibt, möchte er sich entscheiden.
„Man muss sich für eine Wirklichkeit entscheiden?"
„Natürlich, um tatsächlich nicht verrückt zu werden, konstruieren wir tragfähige Weltsichten und sind tatsächlich Gefangene unseres Evolutionsspektrums. Schon früh hat mir die Definition des Quantenphysikers Sir Eddington gefallen: ‚Wir können uns die Welt vorstellen wie eine Schattenhand, die man auf einen Schattentisch legt.‘"
Als ihn die Mutter seiner Tochter verlässt, kauft sich Heribert Hirschmann seinen ersten Computer der Marke Amiga. „Damals gab es noch kein World Wide Web, alles war teuer und lief über Telefon ..."
„Tut mir leid, ich versteh‘s sowieso nicht".
„Die meisten verstehen es nicht. Deshalb sehe ich mich auch als so eine Art Missionar. Allerdings vertrete ich einen entwicklungsfähigen Gott, der experimentierfreudige Pioniere braucht."
Der kräftige Schuss Ironie soll dabei nicht verschwiegen bleiben.
Die Bilder im Gips
„Was ist das?"
„Da habe ich mit Fotopapier experimentiert, dafür musste ich meinem Computer Räder montieren, damit ich mit ihm in die Dunkelkammer fahren konnte ..."
Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe, aber offensichtlich wurden dem Computer Informationen eingegeben, der dann über seinen Monitor Fotopapier belichtete. Das Bild wurde also vom Computer gemacht. Ein Teil seiner ersten Farbdrucke auf transparenter Folie wurde übereinander gelagert, in Säckchen mit Speiseöl eingeschweißt und dann in Gips eingegossen; andere vom Monitor belichtete Fotopapiere in Reliefs mit Gips und Bleiplatten eingearbeitet. Sollte hier Kirkegaard zum Salto mortale genötigt werden? Denn bei ihm darf „ins logische System nichts aufgenommen werden, was ein Verhältnis zum Dasein hat, was nicht gegen die Existenz gleichgültig ist".
„Ich mache keine Notizen", sagt Heribert Hirschmann und es klingt, als würde ein General sagen: „Ich mach keine Gefangenen":
„Vor zwanzig, dreißig Jahren war vieles technisch noch nicht möglich, aber mir war schon früh klar, dass ein Paralleluniversum der Information entstehen würde, das man zu eigenständigen Bildgebungen nötigen kann. Anfangs war natürlich vieles, was heute möglich ist, nur Gedankenexperiment. Ich wollte z. B. Vogelzwitschern in eine Schnur knüpfen. Damals war es höchstens möglich, mit einer einfachen Lochkamera einen Platz zu fotografieren und durch die lange Belichtung die Menschen zum Verschwinden zu bringen."
Früh auch schon hat sich Heribert Hirschmann mit dem Morphen von Bildern beschäftigt.
„Damals hat man pro Bild noch sechs bis sieben Stunden gebraucht."
„Du bist also ein Medienkünstler?"
„Was heißt das schon? In den Medien hat man mich so bezeichnet, also hab ich gleich mit den Medien selbst gearbeitet und wir haben den Mörder von Leopold Schöberl gesucht und gefunden."
Der Taxi Unternehmer Leopold Schöberl wurde 1931 ermordet. Das Medienkunstprojekt „G - eine Stadt sucht einen Mörder" wurde im Medienkunstlabor 2006 präsentiert. Bereits 1997 beschäftigt sich eines von Heribert Hirschmanns Konfrontationen mit dem quantenphysikalischen Raum mit Schrödingers Katze. Bei einem anderen von Heribert Hirschmanns Filmprojekten sieht man Sequenzen, die wie eine Vorwegnahme der Bilder von CNN von der Bombardierung Bagdads wirken: Dafür zerlegte er ein französisches Bett, mischte sich aus Chemikalien Reibeflächen, die er großflächig am Stoff auftrug, und darüber schnepfte er, im abgedunkelten Raum, Zündhölzer. Im Künstlerhaus wiederum fertigte er Kopien an, deren Original verschwindet ...
Einige von Heribert Hirschmanns Videos kann man sich auf Youtube ansehen, ihn selbst findet man regelmäßig bei Ausstellungseröffnungen.
„Smalltalk ist wichtig - als sozialer Kitt."
Und er sieht sich alles sehr genau an und bringt das Gesehene auch sehr pointiert auf den Punkt. Wir stehen in einer Ausstellung vor zwei Bildern, die das gleiche Motiv zeigen, allerdings liegen fünfzig Jahre dazwischen.
„Und, was sagst du dazu?"
„Schau, das linke ist farbig und das rechte ist bunt."
Tatsächlich wirkt Heribert Hirschmann bei diesen Ausstellungsbesuchen meist von distanzierter Eleganz wie ein Eintänzer einer Nachkriegszeit, deren Krieg wir anderen versäumt haben. Wieweit ihm seine Smalltalk-PartnerInnen folgen können, sei dahingestellt, denn die meisten anderen Wirklichkeitsentscheidungen sind wohl in rustikaleren Verhältnissen angesiedelt.
Kommen wir zum Fliegenschiss: „Was soll bleiben?"
„Zwei Seiten Propyläen Kunstgeschichte."
„Und was soll da stehen?"
„Heribert Hirschmann. Babylonischer Contemporary Avantgardist."
„In 72 Punkt?"
Erwin Michenthaler
Stand: Mai 2013