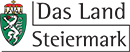Als ich Olga Flor angesprochen habe (*)
Annäherung an eine Autorin, die in halsbrecherischem Tempo vorliest.
Direkt zum *Update 2023
In meinem angegriffenen Zustand begebe ich mich zu einer Lesung in einer Buchhandlung, wo ich unter den Zuhörenden eine junge Frau sitzen sehe, die mich an ein Foto in einer Programmzeitschrift erinnert, und ich spreche sie an, obwohl ich fremde Menschen nur in Notfällen anspreche, sie könnten ja gefährlich sein, und ich sage ihr sicherheitshalber, dass ich nicht wirklich und förmlich, sondern quasi informell mit ihr spreche, und sie scheint zu verstehen, dass mir das ernst ist, ich erlebe eine Art Kulturschock, denn die Angesprochene antwortet druckreif dialektfrei in ganzen Sätzen, was mich vollends verwirrt, sie hat einen Roman geschrieben, den sie gerne verlegt sehen möchte, ich habe einen kleinen Ausschnitt daraus in der Programmzeitschrift gelesen, ihr Name klingt wie ein Pseudonym, sie strahlt gleichzeitig innere Unruhe und Sicherheit aus, aber warum erzähle ich das, ich sollte doch eigentlich über ihre Romane schreiben, aber die können für sich selber sprechen, „Kollateralschaden" zum Beispiel in einem gedehnten Sekundenstil, einer Form, die es im Naturalismus gegeben hat, aber „Kollateralschaden" ist gar nicht naturalistisch, und ich muss daran denken, dass Olga in halsbrecherischem Tempo vorliest, sie hat mir einmal fernmündlich einen siebenminütigen Text in gefühlten zwei Minuten vorgetragen, im Minutentakt hören wir in „Kollateralschaden", was Menschen denken und wahrnehmen, während sie einkaufen, es ist ein glasklarer Ausschnitt sozialer Wirklichkeit im Zustand zunehmender Vereisung, zugleich komisch und deprimierend, all diese biederen Ungeheuer mit ihrem Wunsch, in einem System aufzugehen, das ihren eigentlichen Bedürfnissen nicht gerecht wird, selbst der stolze Sandler ist widerlich in seinem Neid auf die bettelnden Roma, der Jugendliche, der mit seinem Sturmlauf durch den Konsumtempel den Kollateralschaden herausfordert, ist eine Hoffnung, die auf der Strecke bleibt, es ist eine furchterregende Welt, die hier entworfen wird, es dürfte sich um unser neoliberales Elysium handeln, ich kannte, als ich Olga Flor ansprach, ihren Text „Lilith" noch nicht, die Darstellung eines Lustmordes aus der Perspektive der Täterin, sonst wäre sie mir vielleicht unheimlich gewesen, aber auch meine eigene Gegenwart ist mir mitunter unbehaglich, sie hatte den Roman „Talschluss" noch nicht geschrieben, geschweige „Die rechte Braut", Keimzelle und Vorgeschichte zu „Kollateralschaden", aber in diesen Minuten wird mir klar, dass sie das alles schreiben werde, in Flann O'Briens Kolumnensammlung „Trost und Rat" gibt es eine Auflistung von Langweilern, darunter den „Mann, Der Es Im Manuskript Gelesen Hat", nun, ich bin so einer, ich habe Olga Flors ersten Roman „Erlkönig" im Manuskript gelesen und konnte ihren klaren bösen Blick auf die Widersprüche heutiger Existenzformen zwischen Zweckrationalität und Auflehnung kennenlernen, auch ihren im Herbst 2012 erscheinenden Roman „Die Königin ist tot", ihr Meister(innen)stück, in dem Motive aus Shakespeares „Macbeth" in die Gegenwart projiziert werden, die Monstrosität der Ich-Erzählerin wird schon auf den ersten Seiten - einem virtuosen, betont kaltschnäuzigen Einstieg - überdeutlich, das hat eine gewisse Karikaturnähe, wird aber nie ganz zur Karikatur, behält seine Unheimlichkeit, die Figur wird innerhalb ihrer Figurenrede kritisiert, was diese Lady Macbeth der Medienwelt antreibt, ist „das eigene Vorankommen", ein buchstäblich mörderischer Ehrgeiz, sie hasst die Verhältnisse, denen sie sich scheinbar anpasst in einem verzweifelten Versuch der Selbstbestimmung, die in einer patriarchalischen Welt für sie nicht vorgesehen ist, Sexualität ist in diesem Zusammenhang nichts als Machtausübung, aus der Warte der Ich-Erzählerin eine Dienstleistung, Vorleistung für die Ehe, diese Form der Verdinglichung hat allerdings auch hinreißend komische Momente, es ist ein vordergründig zynisch wirkender Text, der letztlich alles andere als zynisch ist, denn der Roman lässt sich als Anklage gegen unhaltbare gesellschaftliche Verhältnisse lesen, eine zunehmende Martialisierung angesichts ökonomischer Krisen, wie in einem geschlossenen System wird hier alles auf Entfremdung hin konstruiert, mit dem gemeinschaftlichen Mord als Liebesbeweis, aber ich sollte nicht zuviel über diesen Text verraten, ich habe noch gar nicht gesagt, wie schön ich den Schluss von „Talschluss" finde, „die Zunge moosbewachsen", offiziell habe ich „Die Königin ist tot" gar nicht gelesen, vielleicht habe ich den neuen Roman sogar erfunden, wie ich ja gegenüber Olga betont habe, unser erstes Gespräch habe nie stattgefunden, und auch heute, viele Gespräche später, denke ich mir, im Grunde hat diese Einschränkung für alle Gespräche gegolten, das eigentliche Gespräch ist in eine unbestimmte Zukunft verschoben, wo wir uns dann rückhaltlos austauschen werden ...
Günter Eichberger
März 2012
*Update 2023: Preise pflastern ihren Weg
Die Liste der Preise, die Olga Flor in den letzten Jahren für ihr Schaffen erhalten hat, ist beeindruckend - angefangen vom Literaturförderpreis der Stadt Graz 2011 über den Reinhard-Priessnitz-Preis 2003, den Anton-Wildgans-Preis 2012 und den Veza-Canetti-Preis der Stadt Wien 2014 bis hin zum Droste-Preis der Stadt Meersburg, dem Grazer Franz-Nabl-Preis 2019, dem Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst 2021 und jüngst dem Kärntner Gert-Jonke-Preis 2023. Olga Flor ist damit die vermutlich höchstdekorierte lebende Schriftstellerin der Steiermark. Und sie ist auch eine Autorin, die kontinuierlich Werke vorgelegt hat, die von der Literaturkritik und der Leserschaft gleichermaßen begeistert aufgenommen werden. „... dann wird man ... hineingezogen in einen Sog, in einen Wirbel gewitterartig aufkommender Worte", urteilte Büchnerpreisträger Josef Winkler schon früh - nämlich 2003 - über Flors literarische Sprache, die gesellschaftliche Anliegen mit poetischer Programmatik verbindet.
Sieben Romane und den Essay „Politik der Emotion" hat Flor seit Beginn ihrer schriftstellerischen Karriere vor 25 Jahren veröffentlicht. Zuletzt erschien die literarische Politsatire „Morituri" (2021), die es auf die Shortlist des österreichischen Buchpreises schaffte. „Morituri ist ein Parcours durch österreichische Landschaften, Milieus und politische Verflechtungen und ein Zeugnis moralischer Verkommenheit, von Angepasstheit wie von Aussteigertum, von Obrigkeitshörigkeit bis Verschwörungstrunkenheit. Ein Zeitbild Österreichs im 21. Jahrhundert, satirisch kommentiert, und doch immer in einer ruhigen, distanzierten Sprache vorgetragen", hieß es in der Jurybegründung.
Auch der Roman „Klartraum" (2017) befand sich auf der Shortlist des österreichischen Buchpreises; und bereits „Kollateralschaden" (2008) wurde auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Grazer Autorin auch bei einer dieser renommierten Branchenauszeichnungen als Preisträgerin gekürt wird. Wundern würde es keinen.
Olga Flors Bücher
- Erlkönig. Roman in 64 Bildern, Steirische Verlagsgesellschaft, Graz 2002
- Talschluss. Roman, Paul Zsolnay, Wien 2005
- Kollateralschaden. Roman, Paul Zsolnay, Wien 2008
- Die Königin ist tot. Roman, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2012
- Ich in Gelb. Roman, Jung und Jung, Salzburg 2015
- Klartraum. Roman, Jung und Jung, Salzburg/Wien 2017
- Politik der Emotion. Residenz Verlag, Salzburg 2018
- Morituri, Roman, Jung und Jung, Salzburg 2021
Werner Schandor
November 2023