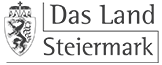„Weil ich ,mono-channeling‘ fad und autistisch finde“
ARTfaces 2009
Anstelle eines Porträts: Ein Interview mit der Autorin Sarah Foetschl
Sarah Foetschl ist eine jener AutorInnen, denen man nicht gerecht wird, wenn man sie einer Disziplin oder einem Genre taxfrei zuschlägt: In eine Diskussion über theatrales Schreiben trägt sie Fragen nach dem Bildungsbegriff und -betrieb; ihre äußerst formbewussten literarischen Arbeiten dienen immer auch der Dokumentation und Montage von recherchiertem „Fremdmaterial"; die (sozial-)wissenschaftlichen, die künstlerischen und die „gender"-Diskurse, in denen sie sich bewegt, sind stets miteinander verzahnt und nicht ohne einander zu denken.
Bald nach Aufführung ihrer bisher größten einzelne Arbeit, „pioneerTM", im Forum Stadtpark übersiedelte sie von Graz-Umgebung nach Wien. Über den „Hirschengarten Graz", das Schimpfwort „Feministin", Spießigkeit im Club-Kontext und kommende Projekte sprach sie mit Stefan Schmitzer.
Stefan Schmitzer: Goldschmiedin, bildende Künstlerin, Dramatikerin, Filmemacherin, Wirtschafts- und Geisteswissenschaftlerin ... Habe ich eine deiner beruflichen Rollen übersehen?
Sarah Foetschl: Goldschmiedin ist nicht ganz treffend. Ich war an einer Höheren Technischen Kunstschule, was wir da gelernt haben, war allgemein Design etwa im Sinne des Bauhauses und sehr viel Kunst- und Architekturgeschichte, Mathematik und technisches Zeichnen. Aber auch Philosophie, speziell Phänomenologie, Literatur und Wirtschaftsrecht waren Pflichtfächer. Hinter dem eigentlich humanistischen Konzept steht ein Abschluss und die Hochschulreife.
Stefan Schmitzer: Das letzte größere „Ding" von Dir, das die Grazer Öffentlichkeit mitbekam, war „pioneerTM- ein Stück Kulturtheorie". Das war zunächst mal ein im Forum Stadtpark aufgeführtes Theaterstück, dann aber auch ein Film, der Filmmaterial von der Aufführung neu montierte. Man kann „pioneerTM" u. a. verstehen als Abgesang auf den „Hirschengarten" (Jelinek) des Grazer Kulturbetriebs, aber auch als mehrfach gebrochene, dabei unterm Strich optimistische Arbeit über ein junges, international agierendes Kulturprekariat oder als feministisches Theater, das Geschlechtermachtdifferenzen auf allen Ebenen gleichzeitig angreift. Sind da Leseweisen dabei, mit denen du dich gar nicht identifizierst? Anders gefragt: Wohin wolltest du mit dem doch sehr umfangreichen Materialberg von „pioneerTM"?
Sarah Foetschl: Diese Leseweise der Deutungsebenen bringen die Struktur meiner Theaterinstallation und des daraus folgendenden Filmes sehr schön auf den Punkt. Der Materialberg ist so eine Sache. Die Effekte von überproportional viel Information, Fehlinformation, Propaganda und wilder Recherche wollte ich da drin haben. Ich mag dieses Phänomen der wild wuchernden Informationen, das uns hilflos und orientierungslos macht. Deswegen habe ich den „Materialberg" auch nicht geschliffen oder eine sinnstiftende lineare Erzählung draus gemacht. Auch wollte ich nicht EINE sinnvolle Deutung des Materials nahe legen. Es ging mir um das Phänomen des Overloads. Ein Phänomen, das im Kern immer zu Tage treten kann, aber als Massenphänomen eben besonders seit Ende des 20. Jahrhunderts. Das wurde im Stück und im Film auch in der formalen Gestaltung bewusst strapaziert. Kerstin Rajnar, Frau Mag Rosa Pink ist ihr Künstlerinnenname, hat mir da medial und software-technisch sehr geholfen, diesen Overload auch in der Bühnen- sowie in der Filmgestaltung ästhetisch zu inszenieren.
Stefan Schmitzer: Obwohl Du es als Materialsammlerin und genaue Rechercheurin vermeidest, diese EINE sinnvolle Deutung nahezulegen, lässt sich doch sagen, dass an prominenter Stelle unter den wiederkehrenden Themen deiner Arbeit die verschiedenen Stränge feministischer Tradition zu finden sind. Bist du eine „feministische Künstlerin"?
Sarah Foetschl: Dieses Stück und der Film beschäftigen sich ja mit der Vergangenheit, auch dieses prominente Jelinek-Zitat nimmt Bezug auf die Literatenszene der 1970er. Und da sah Jelinek zu Recht sehr viele Platzhirsche im Vordergrund und an den Mikros, und deren Frauen bestenfalls im Hintergrund die Fäden ziehend, aber künstlerisch nicht vertreten. Die Gegenwart und die Strukturen der Gegenwart sind andere als in den 1970ern, aber ich kann auch im 21. Jahrhundert nicht anders, als aus einer weiblichen Perspektive zu schreiben und meinen Content abzusondern. Wenn ich sagen würde, ich fühle mich gleich behandelt wie ein Mann in meinem Alter, würde ich lügen. Eine Hauptfigur, die in unserer Kultur immer noch als Identifikationsfigur Nummer eins dient, ist Gott, und der dient den Jungs, aber kleine Mädchen fragen sich wie eh und je: OK, ich kann nicht Gott sein, weil der hat ja 'nen weißen Bart und einen Pimmel, hm, dann muss ich wohl irgendwas anderes sein - jedenfalls nicht das höchste Tier, das sich unser katholisches Krüppelhirn vorstellen kann.
Ein besonderer Knaller war für mich die Erfahrung - ja, das ist mir wirklich passiert -, dass ich mal einen Job nicht bekommen hab', weil der Chefe, ein Mann, meinte: „Hier wird mit Chemikalien gearbeitet und das is' nix für Frauen, weil die kriegen ja immer noch die Kinder." Und das ließ er sich nicht ausreden. Gegen soviel Dummheit muss frau erst einmal ankommen! (lacht) Solange solche Typen gut bezahlte Jobs ausschließlich an Männer vergeben dürfen, darfst du mich gerne eine Feministin nennen.
Stefan Schmitzer: War gar nicht negativ gemeint, die Bezeichnung.
Sarah Foetschl: Oh, „Feministin" ist derzeit aber durchwegs negativ konnotiert - zumindest im österreichischen Mainstream.
Stefan Schmitzer: Ein anderer Punkt, der mir an deiner Arbeit zentral erscheint, ist, was ich ein „teilnehmendes Misstrauen" der Sub- und Gegenkultur gegenüber nennen würde. Du weißt genau, wovon du sprichst, wenn du Proponenten des „links-alternativen" oder „autonomen" Lebens in Österreich vorwirfst, ihrerseits die Strukturen durch die Hintertür zu reproduzieren, die sie verworfen zu haben sich einbilden ...
Sarah Foetschl: Was unter „links-alternativ" zu verstehen ist, möchte ich mal in Frage stellen. Sind das in der Gruppe der unter 30-Jährigen jene, die im Monat weniger als achthundertfünfzig Euro zum Leben haben? Oder ältere Personen mit sozialistischem Hintergrund? Oder sind das Leute, die christliche Tugenden verwirklicht sehen wollen und dabei Atheisten sind?
Stefan Schmitzer: Was verstehst du unter „autonomes Leben" in Österreich?
Sarah Foetschl: Was unter „links-alternativ" zu verstehen wäre, weiß ich auch nicht. Aber die Art deiner Rückfrage zeigt eine bestimmte kritische Stoßrichtung gegen derlei Zuschreibungen. Mir fällt da, um wieder „pioneerTM" heranzuziehen, deine beißende Kritik an den Umgangsformen und Denkweisen im g24-Webforum und im - laut Eigendefinition ja zumindest u. a. um „Autonomie" bemühten - Kulturzentrum „spektral" ein („rosa Flyer für die Mädels" usw.): Dass, wo andere (etwa ich) hoffnungsvolle Netzwerke eigenständig denkender junger Menschen sehen, von deiner Warte aus erst wieder die immer gleichen Rudel junger Männer sichtbar werden, die sich gegenseitig ihrer Coolness und ihres Marktwertes versichern ... Ich meinte nichts anderes als: Du kennst die „Portugalfahrer"-Szene und diverse „alternative Projekte" von innen, und du verhältst dich zu dieser ganzen Tradition von „Alternativen" nicht weniger kritisch als zum Mainstream. Was mir bemerkenswert erscheint.
Die „rosa Flyer für die Mädels", die dort als DJs und Visualists aufgetreten sind, gab es in einem 08/15-Pop-Rock-Schuppen, der Postgarage in Graz. Wir befinden uns im kleinbürgerlichen Club-Kontext, das g24-Webforum bietet Anonymität, wer dort etwas postet, ob nun Techno-Freak oder Wochenend-Revoluzzer, kann niemand wissen. Die „beißende Kritik" in meinem Stück war keine Kritik im Sinne eines Urteils, ich habe ja nur 1:1 Zitate aus einer Online-Debatte übernommen. Das Selbstverständnis einiger männlicher Rezipienten kam da zum Vorschein: Jemand, der als DJ oder Visualist auftritt, macht das, um sich seiner sozialen heterosexuellen Potenz zu vergewissern und weibliche Groupies zu züchten. Gemäß diesem heteronormativen Verständnis müsste man also als PerformerIN lesbisch sein. Zumindest bleibt man als Akteurin in diesem Entertainment-Segment ein „besonderes, exotisches Exemplar" und man wird durch rosarote Flyer vorab „gekennzeichnet". Es geht nicht um musikalisches Können oder kompositorisches Talent, sondern um geschlechtsspezifische Codes, socializing und Differenzierung. Der Erkenntniswert solcher Recherchen bleibt minimal: Der Mainstream des Elektronik-Techno-was-immer-Club-Entertainments ist nicht egalitär, sondern streng heterosexuell ausgerichtet - auch der Nachtclub ist wie der Opernball ein heterosexueller Heiratsmarkt. Und wenn da ein Prozent Frauen als Akteurinnen auf der Bühne auftreten, gibt's schon eine Krise. Dann wird ein neues Genre ausgerufen: DJanes und „girls on decks". Da geht dann aber kein Schwein mehr hin, weil die Hetero-Mädels sich keine Frauen als Sexobjekte auf der Bühne anschauen und Jungs an „Frauenkunst" primär nicht interessiert sind. In der Literatur ist das dann die „Frauenliteratur", im Film das „queer"-Genre, denn die Männerliteratur oder die komplett männerdominierte Filmbranche empfindet sich eben nicht als „Unterkategorie", sondern behauptet von sich, „für alle" zu sein.
Stefan Schmitzer: Dein Zugang zur Literatur ist stark bestimmt von der Recherche. Ich erinnere mich an einige Gespräche, in denen du insbesondere Lyrik dahingehend kritisiert hast, als sie nichts als Lebensgefühl, „Ausdruck von Emotion" und dergleichen beinhalteten, aber keine nachvollziehbaren Ergebnisse brächten. Geht es Dir um eine Zusammenführung der getrennten Bereiche/Institutionen „Bildung" und „Kunst"?
Sarah Foetschl: Also hör mal. In Faktenbergen stecken genauso Emotionen, Lebensgefühle und ästhetische Positionen, umgekehrt stehen hinter lyrischen Formalspielereien Faktenberge. Was ich nicht mag, sind autistische Positionen, die über nichts als die schreibende Persona Auskunft geben und auch formal nichts hergeben. Aber die jüngere Lyrikszene in Österreich ist klein, Ann Cotten macht gute Sachen, ist nun aber auch nach Berlin abgewandert, Nina Bossong, auch Deutschland, beherrscht die Verknüpfung formaler und inhaltlicher Akzente. In Österreich hat sich eher die Poetry-Slam-Szene durchgesetzt.
Stefan Schmitzer: Du studierst ja zur Zeit in Wien. Gibt es aktuelle künstlerische Projekte von dir?
Sarah Foetschl: Grob gesagt: Die Annektierung des Opernballs. Das war jetzt ein Scherz. Ich werd' noch eine Weile im Forum Stadtpark zu finden sein, wo wir uns als „Club 3" (Foetschl, Hofer, Scherzer) um originäre Performance-Formate bemühen. 2010 wird es eine Zusammenarbeit des „Club 3" mit Sophie Reyer und Miriam Mone geben. Arbeitstitel: „Mein Bein ist keine Gitarre". Und ich arbeite mit einer Co-Autorin an einem Gestell für einen Roman, vielleicht wird's aber auch eine Prosa-Collage. Co-Autorin deswegen, weil ich „mono-channeling" fad und autistisch finde.
Stefan Schmitzer, November 2009